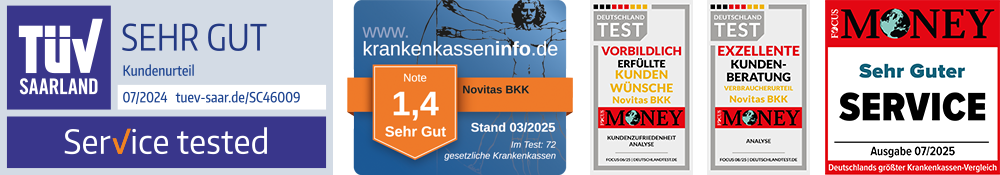Interview mit dem Experten Prof. Dr. med. Arno Deister
BU Prof. Dr. med. Arno Deister (geb. 1957 in Karlsruhe) ist seit 1996 Chefarzt des Zentrums für Psychosoziale Medizin des Klinikums Itzehoe.
Psychosomatische Erkrankungen: Wenn die Seele den Körper krank macht.

Herr Professor Deister, wo liegen im Zusammenhang mit der Psychosomatik die Schwerpunkte Ihrer täglichen Arbeit?
Psychosomatische Erkrankungen verbinden körperliche und seelische Aspekte, daher liegt der Schwerpunkt genau bei den Erkrankungen, bei denen dies der Fall ist. Das sind ganz häufig sogenannte somatoforme Störungen. Bei diesen Krankheitsbildern drückt sich ein seelisches Problem in körperlichen Symptomen aus. Für diese Symptome findet sich dann aber oft keine organische Ursache. Labor- oder Röntgenuntersuchungen zeigen keinen Befund. Die Ursache der Beschwerden finden wir häufig erst wenn, wir den psychischen Bereich beleuchten. Dies macht einen Großteil unserer täglichen Arbeit aus.
Was sind typische Erkrankungen, bei denen sich Symptome auch feststellen lassen?
Zum einen gibt es da die klassischen psychosomatischen Erkrankungen. Dabei liegt ein konkretes körperliches Problem vor, zum Beispiel eine Magenschleimhautentzündung. Wer ständigen Druck verspürt, bei dem kann Bluthochdruck eine typische psychosomatische Erkrankung sein.
Schmerzen, deren Ursache starke Verspannungen sind oder Rückenschmerzen haben oft eine psychosomatische Ursache. Darüber hinaus gibt es Erkrankungen infolge eines krankhaften Essverhaltens, wie Essstörungen oder Adipositas, deren Ursache seelische Probleme sind. Oft werden psychosomatische Erkrankungen aber auch unter der Bezeichnung depressive Störung geführt.
Wenn selbst die klassische Laboruntersuchung keine Auskunft über die Erkrankung gibt. Wie können Sie diese Erkrankungen dann diagnostizieren?
In dem ich mich auf den Patienten wirklich einlasse. Dazu stelle ich verschiedene Fragen, wie zum Beispiel „In welchen Situationen treten welche Symptome auf?“ „Wie geht der Patient mit diesen Symptomen um?“ „Was macht das mit dem Patienten, was denkt er darüber?“ „Was fühlt er, wenn er diese Symptome hat?“ Dabei wird sehr schnell klar, wo die Ursache für die Symptome liegen. Besonders deutlich wird dies bei Angststörungen. Angst hat ganz häufig einen psychosomatischen Aspekt. Menschen, die Ängste haben spüren diese oft auch körperlich. Gespräche sind das wichtigste Instrument um psychosomatischen Erkrankungen auf die Spur zu kommen.
Psychosomatische Erkrankungen sollen extrem auf dem Vormarsch sein. Können Sie das bestätigen?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Da ist sich die Wissenschaft uneins. Ich denke, sie nehmen nicht zu, aber sie werden sehr viel häufiger diagnostiziert. Wir beschäftigen uns heute viel häufiger mit dieser Erkrankung und sie führt immer öfter zu längeren Arbeitsunfähigkeiten. Andersherum haben wir früher oft psychosomatische Erkrankungen entweder übersehen oder sie so nicht bezeichnet. Rückenschmerzen wurden nur als rein körperliches Symptom angesehen.
Spielt dabei auch der immer besser informierte Patient eine Rolle?
Ja, ganz klar. Der spielt eine Rolle und wir fördern dies auch. Ein Patient der sich mit seiner Erkrankung auseinandersetzt, hilft auch uns.
Wie kann ich mir denn als Patient sicher sein, dass meine Probleme/Leiden ernst genommen werden und nicht vorschnell die Diagnose psychosomatische Erkrankung gestellt wird?
Zu einer guten psychosomatischen Diagnosestellung gehört in jedem Fall auch eine körperlich Abklärung. Findet der behandelnde Arzt keine Anhaltspunkte, sollte er den Leidensdruck des Patienten dennoch ernst nehmen. Weitergehende Gespräche führen dann sicherlich dazu, die tatsächliche Ursache für die Beschwerden herauszufinden, ob sie nun körperlicher oder seelischer Natur sind.
Welche Möglichkeiten der Behandlung psychosomatischer Erkrankungen gibt es?
Die wirksamste Methode ist die psychotherapeutische Behandlung. Gespräche können ganz viel bewirken und verändern. Es gibt unterschiedliche Ansätze, aber im Vordergrund stehen heute sicherlich verhaltenstherapeutische Methoden. Es gibt Erkrankungsbilder, bei denen aber andere Therapieformen angewendet werden. Begleitet wird der psychotherapeutische Prozess durch verschiedene Maßnahmen. Eine wichtige Rolle spielen hier zum Beispiel die Bewegung oder auch Entspannungstechniken, insbesondere bei depressiven Erkrankungen. Ein anderer wichtiger Bereich sind psychosoziale Maßnahmen. Dabei beschäftigt sich Arzt mit dem sozialen Umfeld des Patienten. Sowohl im privaten als auch dem beruflichen Bereich gibt es Umstände, die entweder die Heilung unterstützen oder aber verhindern. Veränderungen können hier sehr viel Positives bewirken.
Gilt es nur zu heilen oder kann man auch vorbeugend etwas tun?
Selbstverständlich kann auch viel vorbeugend getan werden. Dem Patienten, der unter einer psychosomatischen Störung leidet muss man zunächst erst einmal helfen. Dabei lernt der Betroffene auch sehr viel über sich. Über seine Stärken aber auch über seine Grenzen. Dies ist sehr hilfreich, damit Menschen lernen besser oder anders mit sich umzugehen. So können psychosomatische Erkrankungen oft verhindert werden.
Was kann ich vorbeugend tun, wenn ich einen stressigen Job habe und mir dessen auch bewusst bin, damit ich keine Rückenschmerzen oder gar einen Tinnitus bekomme?
Ein Tinnitus - ein typischen Symptom von Psychosomatischen Erkrankungen - ist ein Signal und zeigt, das etwas in Schieflage geraten ist. Der Körper zeigt Ihnen, dass Sie etwas für Ihre innere Balance tun müssen damit es Ihnen wieder besser geht. Man könnte auch sagen, es ist ein Warnschuss. Lernen Sie Ihre Grenzen kennen und auch was Ihnen gut tut.
Gibt es denn bestimmte Personen oder Berufsgruppen, die besonders gefährdet sind?
Grundsätzlich können psychosomatische Erkrankungen können bei jedem von uns auftreten. Häufig trifft es jedoch Menschen, die besonders hohe Erwartungen an sich selbst haben und dazu neigen sich zu überfordern. Eine psychosomatische Erkrankung ist kein Hinweis darauf, dass jemand nicht alles bewältigt sondern das er auch mit sich kämpft.
Sie haben gesagt, dass Bewegung auch eine Rolle spielt in der Prävention, sind Sportler da weniger gefährdet?
Man muss unterscheiden wie Sport betrieben wird. Wenn ich von Bewegung spreche meine ich nicht den Leistungssport, bei dem viele über Ihre Grenzen gehen. Ich meine eine ausgewogene Bewegung, die einem gut tut. Wer sich regelmäßig bewegt ist sicherlich weniger gefährdet eine psychosomatische Erkrankung zu bekommen.
Gibt es auch Entspannungstechniken, die sich besonders gut eignen?
Ja, die gibt es. Viele Entspannungstechniken sind sich relativ ähnlich. Gut, sind insbesondere die Techniken, die einen körperlichen Aspekt in den Vordergrund stellen. Ein Beispiel ist die progressive Muskelrelaxation, bei der man ganz bewusst auf seinen Körper, die Muskulatur und den Entspannungszustand achtet. Aber auch autogenes Training oder Yoga eignen sich.
Können Sie vielleicht ein paar Tipps zur Selbstdiagnose geben? Was sind erste Anzeichen, die auf eine mögliche psychosomatische Erkrankung hinweisen?
Das Wichtigste bei psychosomatischen Erkrankungen ist, dass man offen für Signale seines Körpers ist. Einfach regelmäßig in seinen Körper hineinhören und seine Psyche ernst nehmen. Auffälligkeiten, sollten Sie Beachtung schenken und im Zweifel frühzeitig beim Arzt abklären lassen. Es gibt einen schönen kleinen Dialog, wo die Seele zum Körper sagt: „Körper geh du voran und zeige dem Menschen wenn er ein Problem hat.“ Und der Körper sagt: „ Okay Seele, ich werde mal sehen was ich machen kann, damit er sich Zeit für dich nimmt.“
Hier wird die wechselseitige Funktion zwischen Seele und Körper, die beide ihre Aufgaben haben, beschrieben.
Gehen Betroffene zu spät zum Arzt, weil typische Krankheitssymptome wie Fieber fehlen?
Ja, das ist so. Psychosomatische Erkrankungen gehören sicherlich zu den Erkrankungen, die leider sehr spät erkannt werden. Das ist sehr schade, da sie sich richtig gut behandeln ließen, wenn sie frühzeitig erkannt würden.
Vielen Dank.